Anlässlich des Weltfrauentages hat Katharina zur Blogparade „Was hat Geburt mit Feminismus zu tun“ aufgerufen. Lieben Dank dafür. Als Mutter, Frau und einstiege Gebärende nehme ich mich dieses Thema nur zu gerne an. Falls Dich das Thema Selbstbestimmte Geburt darüber hinaus interessiert, empfehle ich Dir sehr Katharinas Manifest (Manifest für eine selbstbestimmte Geburtskultur) zu lesen. Ich hoffe sehr, dass es umgesetzt ist, bevor meine Kinder mich zur Oma machen. Am besten sollte es sofort zur Realität werden.
Warum ist Geburt ein feministisches Thema?
Die Geburt ist untrennbar mit der Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper verbunden. In der Vergangenheit wurden Geburten immer mehr medizinisch und institutionalisiert, ohne dabei die Stimmen der Gebärenden ernst zu nehmen. Die feministische Perspektive setzt sich dafür ein, dass Gebärende informierte Entscheidungen treffen können.
In der Gesellschaft spiegelt die Geburtskultur wider, wie mit weiblicher Autonomie umgegangen wird. Werden Frauen als handelnde Subjekte wahrgenommen, die respektiert werden? Oder müssen sie sich einem System unterordnen? Der Zugang zu Hebammen, außerklinischen Geburten und der Umgang mit Interventionen zeigen, wie viel Kontrolle über ihren eigenen Körper die Gesellschaft weiblich gelesenen Personen zugesteht.
Eine selbstbestimmte Geburt kann eine stärkende Erfahrung sein, während eine fremdbestimmte ein Gefühl von Ohnmacht und ausgeliefert sein hinterlassen kann. Deswegen ist es so wichtig, die Gebärenden respektvoll zu begleiten, sie in die Lage zu versetzen, informierte Entscheidungen zu fällen und die Geburt als prägende Erfahrung für Mutter und Kind anzuerkennen.
Selbstbestimmte Geburt: Was bedeutet das?
Eine selbstbestimmte Geburt bedeutet, als gebärende Person das uneingeschränkte Recht zu haben, über den eigenen Körper und den Ablauf der Geburt zu entscheiden. Dies geschieht frei von Druck oder ungefragten Eingriffen. Es geht darum, als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht in irgendwelche Zeitpläne, Finanzvorgaben oder sonstige lustige Ideen passen zu müssen. Jede Geburt ist anders und läuft anders ab. So wie jeder Mensch anders ist. Bei einer selbstbestimmten Geburt spielen alle diese Vorgaben keine Rolle.
Informierte Entscheidungen
Wichtige Grundlage dafür ist, dass die gebärende Person möglichst umfassend über alle Eingriffe, Alternativen und deren Risiken aufgeklärt wird. Dies hat auf Augenhöhe und ohne unnötige Fachbegriffe zu geschehen, damit sie aufgrund dieser Informationen eine qualifizierte Entscheidung treffen kann.
Körperliche Autonomie
Gebärende sollten jederzeit über ihren Körper bestimmen können, ob sie sich bewegen möchten, welche Positionen sie einnehmen und ob sie Schmerzmittel nehmen möchten oder nicht. Diese und andere Entscheidungen obliegen einzig und allein den Gebärenden, und medizinische Interventionen geschehen niemals ohne ihre Zustimmung.
Wahlfreiheit des Geburtsortes
Zur Selbstbestimmung gehört auch die freie Wahl des Geburtsortes. Die Gebärende entscheidet, ob es eine Klinik, ein Geburtshaus oder die eigenen vier Wände sein sollen. In vielen Gegenden sind Hebammen und Geburtshäuser Mangelware, und auch die Kliniken, in denen Kinder zur Welt kommen können, werden leider immer weniger.
Selbstbestimmte Geburt bedeutet im Ergebnis, die Schwangere und Gebärende als Expertin für ihren eigenen Körper und ihr ungeborenes Kind wahrzunehmen und anzuerkennen. Ihre Ängste, Wünsche und ja, auch ihr Bauchgefühl sind unter der Geburt mindestens so wichtig wie medizinische Fakten. Eine Geburt, die in diesem sicheren Gefühl begleitet wird, kann ein stärkendes Ereignis für die Gebärende sein. Während eine Geburt, die unter Zeitdruck, Ignoranz oder gar mit körperlicher oder emotionaler Gewalt begleitet wird, zu einem traumatischen Erlebnis werden kann, welches Mutter und Kind über Jahre negativ beeinflusst.
Strukturelle Hürden und patriarchale Machtverhältnisse im Geburtssystem

Geburt zwischen Tradition und moderner Medizin
Eine Legende in meiner Familie besagt, dass meine Ur-Ur-Oma ihr inzwischen zehntes Kind während der Ernte auf einem Acker bekommen haben soll. Kurz die Nabelschnur durchgeschnitten, die Nachgeburt abgewartet, das Kind ins Tagebuch und weiter ging es mit der Ernte. Ich halte das für eine nette Geschichte, wage aber zu bezweifeln, dass sie stimmt.
Die Geburtshilfe ist seit Jahrhunderten von patriarchalen Strukturen geprägt. Früher lag die Begleitung der Geburt in den Händen einer Hebamme oder, wenn nichts Kompliziertes zu erwarten war, fand sie einfach allein oder in Gesellschaft von Frauen statt, die bereits Erfahrung hatten. Mit dem Fortschritt der medizinischen Forschung wurden Geburten immer weiter in Krankenhäuser verlegt und geritten dort unter die Dominanz vornehmlich männlicher Ärzte.
Heute spüren Gebärende die Auswirkungen davon immer mehr: Ihre Bedürfnisse sind unwichtig und sie müssen standardisierten Abläufen und wirtschaftlichen Vorgaben unterordnen.
Die Geburt meiner Tochter sollte, nachdem der Größe unter wenig vertrauenerweckenden Umständen schließlich mit einem Kaiserschnitt geholt wurde, in einem Geburtshaus stattfinden. Es kam der errechnete Termin und das Kind hatte andere Pläne, als auszuziehen. Es verging eine Woche, in der wir täglich bei der Ärztin zum CTG waren, und es verging eine zweite Woche.
Mein Bauchgefühl sagte mir, es wäre alles gut. Die Pläne der Ärzt:innen waren da anderer Ansicht. Freitagmorgen, errechneter Termin plus 14 Tage, wurde es der Ärztin zu bunt. Wir sollten sofort ins Krankenhaus fahren, damit die Geburt eingeleitet wurde. Außer dem Zeitplan gab es dafür keinerlei Indikation. Mir ging es gut, dem Kind ging es gut, die Werte waren alle super. Der Arzt im Krankenhaus, welches eng mit dem Geburtshaus zusammenarbeitet, hat sich all das angesehen, nochmal einen Ultraschall gemacht und den errechneten Termin nach hinten verschoben. Auf diese Weise hat er uns nochmal drei Tage herausgeholt.
In der Nacht von Sonntag auf Montag ging die Geburt dann tatsächlich auch los. Eingeleitet wurde dann am Montag trotzdem. Nach all den Untersuchungen und CTGs und keine Ahnung was noch allem, wäre das der Zeitpunkt gewesen, das tatsächlich mal zu tun und zu sehen, dass keine Intervention nötig ist. Vermutlich hat es in diesem Fall die Geburt einfach nur beschleunigt. In anderen Fällen wäre es wahrscheinlich der Weg in eine Spirale der medizinischen Eingriffe gewesen. Die Begleitung durch die Hebamme aus dem Geburtshaus, der später eine Ärztin der Klinik assistiert hat, die vor dem Studium einige Jahre als Hebamme Erfahrung gesammelt hatte, war einfach nur Gold wert. Ich hatte eine schöne zweite Geburt. Es war anstrengend, keine Frage. Aber ich hatte eine Sekunde, in der ich an Schmerzmittel gedacht habe oder das Gefühl hatte, es nicht mehr auszuhalten.
Diese Geburt und der Umgang im Vorfeld und auch danach haben mich nach dem Kaiserschnitt wieder mit meinem Körper versöhnt. Die Erfahrung, wie wichtig es ist, in diesem Moment, in dem man als Frau und Mutter seinen Mitmenschen hilflos ausgeliefert ist, das Wissen hat, Vertrauen zu können, hat viele Wunden heilen können. Wenn ich heute sage, meine Tochter ist offiziell „ET+18“ geboren, werde ich nur schockiert angesehen. Das dürfte es nicht geben. Doch, das müsste es viel öfter geben.
Meine Geburt fand in aller Ruhe und in vertrauensvoller Umgebung statt und, bis auf die Einleitung am Anfang, ohne medizinische Interventionen. Eigentlich sollte es immer so laufen und nur in den Fällen, in denen das Leben von Mutter und/oder Kind in Gefahr ist, in die Trickkiste gegriffen werden. Frauen bekommen, seit es Menschen gibt, Kinder. Das geht meistens gut und manchmal schief.

Medizinische Standards vs. Selbstbestimmte Geburt
Geburten laufen oft nach festen Plänen, in denen Effizienz und Risikominimierung wichtiger sind als die Bedürfnisse der Gebärenden. Routinemäßig wird eine dauerhafte CTG-Überwachung gemacht, ein Wehentropf angeschlossen und die Gebärende in eine liegende Position gebracht. Dies geschieht häufig nicht aus einer medizinischen Notwendigkeit heraus, sondern weil es für das Personal praktischer ist. Obwohl man längst weiß, dass andere Positionen für eine Geburt sicherer und interventionsärmer sind.
Was daraus folgt, ist das, was man „Cascade of Interventions“-Effekt nennt. Auf eine Intervention folgt die nächste. Unter dem Wehentropf werden die Wehen so stark und nicht mehr aushaltbar, dass eine PDA hermuss. Mit der PDA lassen sich ganz viele Geburtspositionen aber nicht mehr einnehmen und, wenn es ganz schlecht läuft, führt dies zu einem Kaiserschnitt. Eine Kettenreaktion, die nicht selten unnötig ist.
Ein zentrales Problem dabei ist die medizinische Übervorsicht. Häufig steht nicht die Frage im Vordergrund, was für die Gebärende am wichtigsten ist, sondern welches Vorgehen das geringste rechtliche Risiko mit sich bringt oder sich finanziell am meisten lohnt. Klassisches Beispiel dafür ist die steigende Kaiserschnittrate. Sobald eine vaginale Geburt auch nur das kleinste Risiko birgt, entscheiden Ärzte:innen sich für den vermeidlichen sichereren Eingriff, um sich selbst abzusichern: den Kaiserschnitt.
Dieser Eingriff, der großartig und sehr sinnvoll ist, wenn es zu Komplikationen unter oder schon vor der Geburt kommt, bringt auch Risiken mit sich. Für die Kliniken hat er allerdings einige Vorteile:
- Ein Kaiserschnitt ist planbarer. Während sich eine vaginale Geburt über Tage hinziehen kann, ist ein Kaiserschnitt schnell erledigt.
- Er ist lukrativer. Ich habe die Rechnungen von beiden Geburten gesehen. Die Operation, die ein Kaiserschnitt ist, und wirklich nur diese, war etwa genauso teuer wie die vaginale Geburt inkl. Hebammenbegleitung im Vorfeld und im Nachhinein.
- Es braucht weniger Personal. Eine lange, unberechenbare Geburt bindet schlicht mehr Menschen und Räumlichkeiten als eine schnell durchgeführte Operation.
- Das Risiko von juristischen Auseinandersetzungen ist geringer. Geburtshilfe ist voller Risiken. Egal, wie erfahren das Personal ist, jede Geburt ist anders und es kann immer etwas schief laufen. Im Vergleich ist der Kaiserschnitt ein sehr sicheres Verfahren mit wenigen direkten Risiken für Mutter und Kind. Ein Kaiserschnitt bringt allerdings u.a. als Spätfolge das Risiko von Allergien und Übergewicht für das Kind mit sich.
Man geht davon aus, dass etwa 15 % aller Geburt ein so hohes medizinisches Risiko mit sich bringen, dass ein Kaiserschnitt die beste Lösung darstellt. Die Rate in Deutschland schwankt, ist aber in etwa doppelt so hoch (mehr dazu: https://www.gerechte-geburt.de/wissen/kaiserschnitt-info/).
Diese Entwicklung ist eng mit patriarchalen Strukturen verknüpft. Weibliche Körper werden nicht als kompetente, selbstbestimmte Einheiten betrachtet, sondern als potenzielle Gefahrenquellen, die es zu überwachen und zu regulieren gilt. Die Idee, dass die Geburt ein natürlicher Vorgang ist, wird durch die Meinung ersetzt, dass sie nur mit maximaler Kontrolle sicher ablaufen kann.
Informative Links zu Kaiserschnitten:
- Statistisches Bundesamt: Krankenhausentbindungen in Deutschland
- Mother Hood e.V: Kaiserschnittrate in deiner Region
Machtgefälle zwischen Gebärenden und medizinischem Personal
Die Ärztin, die meine Geburt begleitet hat, hat der Hebamme assistiert. Eine weitere Ärztin, die sich mir zwar kurz vorgestellt hatte, die ich aber höchstens zur Kenntnis genommen habe, hielt sich im Hintergrund bereit und hat protokolliert. Sie habe ich erst wieder wahrgenommen, als meine Tochter auf der Welt war und sie irgendwas aus einem der Schränke geholt hat.
Üblicherweise herrscht in den Kliniken auch auf den Geburtsstationen ein anderes Machtverhältnis. Dort haben die Ärzt:innen das Sagen, die Hebammen sind meist in ihren Entscheidungen sehr eingeschränkt und die Gebärenden haben nur wenig zu melden. Das zeigt sich häufig in Situationen, in denen Ärztinnen und Ärzte Entscheidungen treffen und Maßnahmen anordnen, ohne dabei eine qualifizierte Zustimmung der Gebärenden einzuholen. Studien belegen, dass viele Frauen unter solchen Umständen übergriffige oder traumatische Erfahrungen machen.
Strukturelle Benachteiligung bestimmter Gruppen
Nicht jede Gebärende erfährt die gleichen Bedingungen. Häufig erleben etwa People of Color, Menschen mit Behinderung, sozial benachteiligte oder sehr junge Menschen Diskriminierung unter der Geburt oder auch schon im Vorfeld. Fehlende Sprachkenntnis, Vorurteile oder nur eingeschränkter Zugang zu alternativen Geburtsmodellen sind dabei nur ein Teil der möglichen Hürden. Feministische Geburtskultur bedeutet auch, solche strukturellen Ungleichheiten aufzudecken, zu thematisieren und abzubauen.

Wege zu einer gebärfreundlichen Geburtshilfe
Immer mehr Stimmen fordern eine gebärfreundlichere Geburtshilfe. Hebammen, Doulas und Frauen kämpfen für das Recht auf eine respektvolle und interventionsarme Geburt und machen sich für die Rechte von Gebärenden stark. Doch für echte Veränderungen braucht es ein Umdenken – weg von einem medizinisch dominierten, zu einem selbstbestimmten Geburtsverständnis. Zu einem Verständnis, dass Frauen als Expertinnen ihres eigenen Körpers begreift.
Dazu gehört:
- Kontuität in der Betreuung.
Begleitung durch eine Hebamme während des gesamten Verlaufs der Geburt reduziert das Risiko unnötiger Eingriffe und stärkt das Sicherheitsgefühl der Gebärenden. - Recht auf informierte Entscheidungen.
Gebärende müssen das Recht auf echte Wahlmöglichkeiten und umfassende Aufklärung über Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen haben. - Ende der Defensivmedizin.
Ärztinnen sollten nicht aus Angst handeln müssen, sondern auf Basis der Abwägung von Notwendigkeiten und dem Willen der Gebärenden. - Gesellschaftliches Umdenken.
Eine Geburt ist eine Naturgewalt, keine Frage. Doch sie sollte als etwas Natürliches betrachtet werden und nicht als eine Gefahr. Bildung und Aufklärung sind wichtig, um diese Meinung zu ändern.
Mehr dazu:
- Gesellschaft für Qualität in der außenklinischen Geburtshilfe e.V.: WHO-Empfehlungen zur normalen Geburt
- WHO: Vermeidung und Beseitigung von Geringschätzung und Misshandlung bei Geburten in geburtshilflichen Einrichtungen
Feministische Perspektiven und intersektionale Ansätze
Eine Geburt ist nicht nur eine sehr individuelle Erfahrung, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, das von sozialen Normen und Ungleichheiten geprägt ist. Feministisch auf die Geburtshilfe zu schauen bedeutet daher nicht nur für Selbstbestimmung zu kämpfen, sondern auch die verschiedenen Ausgangslagen und Hürden zu erkennen mit denen manche Gruppen konfrontiert sind.
Wer hat Zugang zu einer selbstbestimmten Geburt?
In der Theorie hat jede Schwangere in Deutschland die Möglichkeit, den Ort und die Umstände der Geburt ihres Kindes selbst zu wählen. Sie kann zwischen Klinik, Geburtshaus und Hausgeburt aussuchen. In der Praxis gibt es diese Wahl für viele nicht. Die Gründe dafür können schlicht fehlende Angebote sein. Besonders Geburtshäuser gibt es nur wenige und sie sind oft so voll, dass man sich meist schon bei dem Gedanken eventuell schwanger werden zu wollen, dort anmelden muss. Auch Kliniken werden immer weniger und in ländlichen Gegenden wird es immer schwieriger eine geeignete Einrichtung zu finden. Oft fehlt es auch an den nötigen finanziellen Mitteln, damit eine Geburt wirklich genauso wie gedacht stattfinden kann. Auch wenn das meiste die Krankenkasse übernimmt, benötigt es beispielsweise für eine Hausgeburt oft Dinge, die nicht im Leistungskatalog enthalten sind.
Ganz besonders trifft es Gebärende, die außerdem noch auf diskriminierende Strukturen treffen:
- BIPoC (Black, Indigenous, People of Color):
Studien zeigen, dass farbige Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund weltweit die schlechteren Geburtserfahrungen machen. Das liegt an mangelnder Aufklärung, Vorurteilen und häufig schlechterer medizinischer Versorgung. - Menschen mit Behinderungen:
Geburtsräume und -prozesse sind meist nicht barrierefrei. Häufig fehlt es an der Bereitschaft auf besondere Bedürfnisse einzugehen oder die baulichen Begebenheiten sind nicht darauf angelegt. Meine frühere Ärztin war im dritten Stock ohne Aufzug und Parkplätze in der Nähe waren auch Mangelware. Das habe ich spätestens ab dem siebten Monat verflucht und mir ging es in den Schwangerschaften wirklich gut. Zudem erleben Menschen mit Behinderungen häufiger eine bevormundende Behandlung durch medizinisches Personal. Gleiches gilt übrigens auch für sehr junge Schwangere. - Queere und trans* Personen:
„Frauen bekommen Kinder“ so sieht es unsere Gesellschaft fast ausschließlich und lässt dabei außer acht, dass eben nicht alle gebärenden Menschen zwangsweise auch Frauen sind. Für trans*Männer und nicht-binäre Menschen ist der Zugang zu einer respektvollen Geburtshilfe häufig erschwert, weil viele Kliniken und Geburtsbegleiter:innen nicht auf geschlechtliche Vielfalt eingerichtet sind. - Sozial benachteiligte Frauen:
Wer wenig Geld hat oder in einer ländlichen Region lebt, hat oft keinen Zugang zu Hebammen oder alternativen Geburtsmodellen. Private Zusatzleistungen, wie eine Beleghebamme, sind nicht für alle finanzierbar.
Geburtshilfe als Spiegel gesellschaftlicher Machtverhältnisse
Wie Geburtshilfe organisiert ist und für wen sie offen ist, zeigt, wie unsere Gesellschaft mit Gebärenden umgeht. Die patriarchale Kontrolle über den weiblichen Körper beginnt aber nicht erst in der Geburtshilfe, sondern zieht sich durch viele andere Bereiche. Von der Frage, wer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und Verhütungsmitteln hat, über die Betreuung unter Geburt und im Wochenbett, bis hin zur Kinderbetreuung und -finanzierung. An vielen Stellen massen sich Männer an, besser über die Wünsche und Bedürfnisse von Frauen Bescheid zu wissen, als die Frauen selbst.
Intersektionale Geburtshilfe als Ziel
Für eine selbstbestimmte Geburt zu kämpfen heißt nicht nur aus der Position von weißen, privilegierten Mittelstandsfrauen zu denken, sondern alle miteinzubeziehen. Das heißt:
- Ärzt:innen, Hebammen und Geburtsbegleiter:innen sollten in rassismuskritischer, intersektionaler und gendersensibler Geburtskultur geschult werden.
- Es muss flächendeckend für tatsächlich freie Wahlmöglichkeiten des Geburtsortes gesorgt werden.
- Geburtshilfe muss inklusiv sein und alle gebärenden Personen mitdenken.
Fazit: Es gibt noch viel zu tun!
Die medizinische Versorgung in Deutschland ist auf einem hohen Niveau. Leider werden dabei oft die Menschen vergessen und in ein System gesteckt, welches auf Effizienz ausgelegt ist. Eine zukunftsfähige Geburtshilfe muss die Gebärenden in den Vordergrund stellen und aus ihrer Sicht gedacht sein. Welche Gedanken hast Du dazu?
-
[…] Selbstbestimmte Geburt: Warum Geburt ein feministisches Thema ist […]
Einen Kommentar hinterlassen

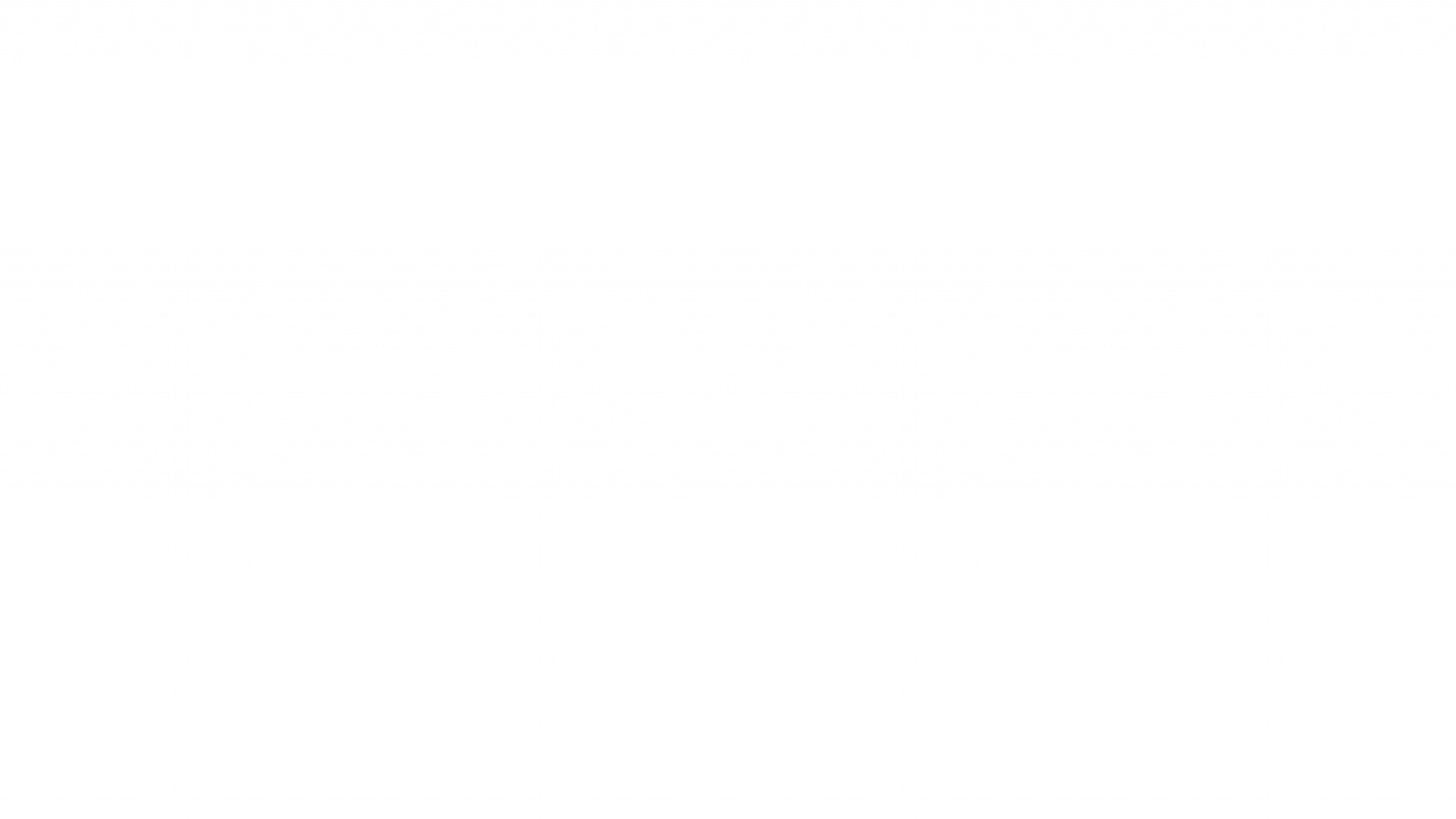
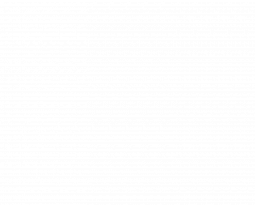




liebe Hilke, was für ein Plädoyer! Danke, dass du auch von deinen eigenen Erfahrungen berichtet hast. Und danke ganz generell für deinen Einsatz für Gleichberechtigung und kritisches Denken!